Verschwundene Arbeit,
untergegangene Berufe in Leutershausen
Ein Kalender von 1997,
herausgegeben vom CDU-Ortsverband Leutershausen,
sammelte in liebevoller
Arbeit die alten, untergegangen Berufe.
Die Idee und Konzeption stammen von Josef Fey,
der mir erlaubte, seinen
Text und die Bilder für unsere Galerie zu verwenden.
Hiefür möchten ich
ihm herzlich danken.
Danken möchten wir auch allen Beteiligten
für die Überlassung von
Bildmaterial und Gedankengut.
Frau Ursula Kowitz aus Leutershausen
danken wir für die freundliche Überlassung Ihres
Kalenders zur Bearbeitung
für die Bildergalerie.
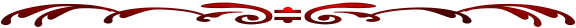
|
|
Der Amtsdiener |
 Georg
Probst Georg
Probstgeb. am 10.03.1907 in Leutershausen |

Die Tätigkeit als Amtsdiener war in den früheren Jahren eine wichtige
Aufgabe in der Gemeinde. Georg Probst wurde dieses Amt ab 1. September
1952 übertragen, nachdem er zuvor ab 1948 als Vorarbeiter bei der
Gemeinde Leutershausen beschäftigt war. Mit dieser Tätigkeit war das
Ausschellen, also die Verlautbarung der öffentlichen Bekanntmachungen
verbunden. An 39 Stellen im Ort ließ er die Ortsschelle ertönen. Es
öffneten sich Türen und Fenster um die neuesten Mitteilungen des
Bürgermeisteramtes zu erfahren. Zu jener Zeit hatten die Bauern und
Handwerker ihre Pferdefuhrwerke oder die Handkarren angehalten, wenn
der „Schelle-Schorsch“ seine Stimme ertönen ließ. Diese Art der
öffentlichen Bekanntmachung wurde am 31. Dezember 1964 eingestellt, da
ab 1. Januar 1965 das Mitteilungsblatt der Gemeinde erschien. Der
Dienst des Amtsdieners wurde damit allerdings nicht beendet, denn nach
wie vor waren Briefe zuzustellen, Mitteilungen zu übermitteln, Plakate
auszuhängen oder sonstige Mitteilungen an den Anschlagtafeln
anzubringen. Georg Probst schied am 1. April 1972 aus dem Dienst der
Gemeinde Leutershausen aus und trat in den Ruhestand.
Georg Probst erlernte bei Johann
Leitwein in Großsachsen das Malerhandwerk und war dort viele Jahre als
Geselle tätig, ehe er sich im August 1933 selbstständig machte und
einen eigenen Handwerksbetrieb gründete, den er bis 1936 führte.
Danachtrat er bei der Post in den öffentlichen Dienst. 1940 wurde er
zum Wehrdienst eingezogen und war bis Kriegsende Soldat. Nach kurzer
Gefangenschaft und Rückkehr in die Heimat arbeitete er in einer
Schweißerei.
Georg Probst hat sich auch in
der Freizeit in den Dienst der Allgemeinheit gestellt. So gehörte er
mehr als 70 Jahre dem Roten-Kreuz-Ortsverein an und stand Jahrzehnte
in den Reihen der Aktiven. Seit mehr als 70 Jahren ist er aktiver
Sänger beim Männergesangverein 1884 e.V. Leutershausen, wo er ebenso
wie beim DRK zu den Ehrenmitgliedern zählt.
|
zurück
|
|
Der
Bierbrauer |
 Heinrich
Schröder Heinrich
Schrödergeb. am 13.06.1888 in
Leutershausen,
gest. am 06.12.1977 in Leutershausen |
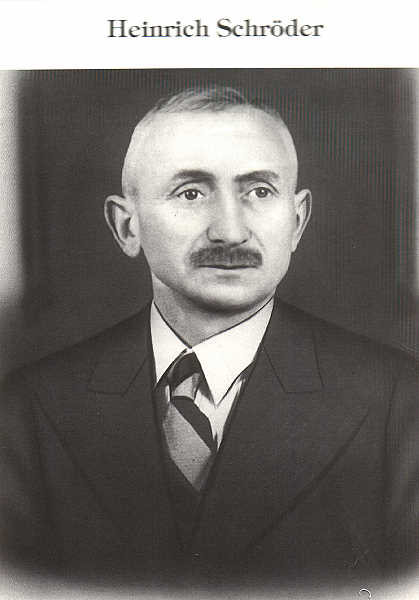
Heinrich Schröder erlernte das väterliche Handwerk um die Tradition
der im Jahre 1847 gegründeten Brauerei Schröder fortzusetzen. Seine
Gesellenjahre verbrachte er in München, Koblenz und Berlin. In Berlin
absolvierte er noch ein Studium an der Brauerei-Akademie. Im ersten
Weltkrieg war Heinrich Schröder wie seine Brüder Soldat, so daß sie
als Hilfe im Brauereibetrieb ausfielen. Der Vater Johannes Schröder
mußte, da er selbst gesundheitlich angeschlagen war, den Braubetrieb
einstellen. Er verstarb am 26. Dezember 1923, und nach dem Tod seiner
Ehefrau im Jahre 1925 ging der Betrieb auf die sechs Kinder über, die
ihn am 11. Februar 1926 als Familien GmbH wieder eröffneten. Am
Ostersamstag 1926 kam das erste Bier in altbekannter Qualität zum
Ausschank. Dank der guten Unterstützung seitens der Leutershausener
Bevölkerung und aufgrund der Bierqualität könnte ein guter und treuer
Kundenstamm aufgebaut werden. Am 18. März 1937 traten vier Geschwister
aus der Gesellschaft aus und verkauften ihre Anteile an die
Gesellschafter Heinrich Schröder und Sofie Ost, geb. Schröder.
Heinrich Schröder zog sich 1958 aus dem Betrieb zurück. Damit ging die
Brauarbeit in Leutershausen zu Ende, da der Sohn Hans Schröder, der
den Brauberuf erlernt hatte, im zweiten Weltkrieg in Russland gefallen
ist.
Brauer und Mälzer sind
interessante Berufe. Das Bier wird heute noch nach dem ältesten
Lebensmittelgesetz der Welt aus dem Jahre 1516 hergestellt. Zum
Bierbrauen ist die richte Dosierung von Wasser, Hopfen, Malz, Hefe und
Know-how wichtig.
Bier gibt es seit mehr als 6000
Jahren. Den Sumerern, einem Volk das zwischen Euphrat und Tigris, dem
heutigen Irak, lebte, wird die Erfindung zugeschrieben.
Auch wenn sich die Herstellung
von Bier grundsätzlich einfach anhört, so steckt doch eine ungeheure
Portion Erfahrung, Sorgfalt, Sauberkeit und Know-how dahinter.
Jedes der in Deutschland
gebrauten über 4000 verschiedenen Biere hat eine eigene Rezeptur.
|
|
|
zurück
|
| Die
Botengängerin |
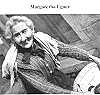 Margaretha
Egner Margaretha
Egnergeb. am 08.12.1866 in
Leutershausen,
gest. am 09.06.1960 in Leutershausen |
|
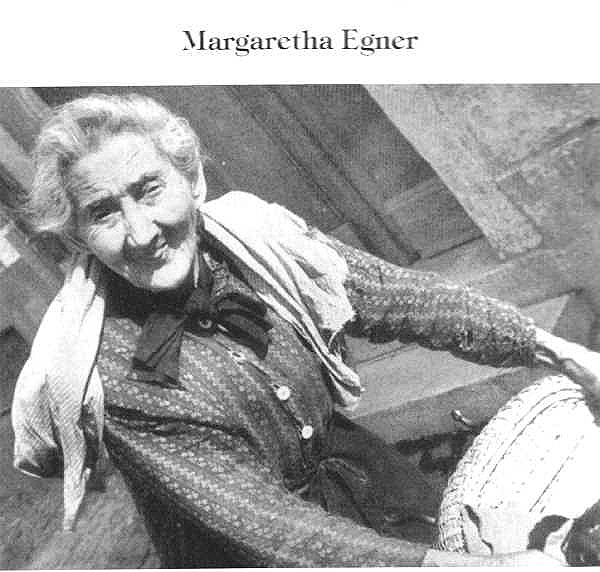
Margaretha Egner, liebevoll
„Schwester Gretchen“ genannt und auch so nur weithin bekannt, war über
Jahrzehnte hinweg als Arzneibotin von Leutershausen nach Schriesheim,
und wieder zurück, unterwegs. Sie nahm die ärztlichen Verordnungen
entgegen, sammelte sie und holte in der Apotheke in Schriesheim die
Arzneimittel ab um sie den Kranken zuzustellen. Diesen wertvollen
Botendienst übte Margaretha Egner bis ins hohe Alter aus.
Margaretha Egner war ledig. Sie
soll in ihrer Jugend eine äußerst hübsche Erscheinung und Männern
gegenüber sehr wählerisch gewesen sein, so daß sie letztlich den
Anschluß verpaßte. Mit 35 Jahren nahm sie ein Kind (Mädchen) an, zog
es groß und vermachte ihm ihr Vermögen.
„Schwester Gretchen“ soll
abergläubig gewesen sein. So habe sie Haarnadeln in die Fensterbank
gesteckt und am Abend, vor dem Schlafengehen, drei weiße Kreuze an
der Schlafzimmertür angebracht. Im Alter, so war zu hören, soll sie es
mit der häuslichen Hygiene nicht mehr so genau genommen haben. Auch
Haustiere sollen hie und da in ihrer Wohnung zu finden gewesen sein.
Margaretha Egner starb im Alter
von 94 Jahren ohne vorher je einmal krank gewesen zu sein.
|
|
|
zurück
|
| Der
Farrenwärter |
 Johannes
Löb Johannes
Löb
geb. am 11.11.1913 in Emental/Besarabien,
gest. am 06.06.1996
|
|
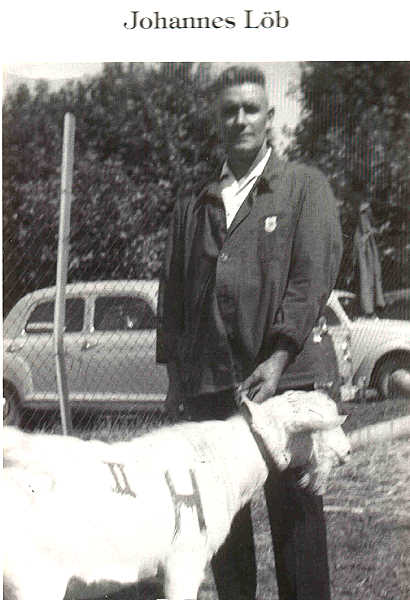
Er war in seiner Heimat nach der
Tätigkeit im elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb selbständiger
Landwirt. Nach der Vertreibung fand er in Leutershausen eine zweite
Heimat und war bis 1952 in verschiedenen Firmen tätig. Ab 1. Oktober
1952 trat er als Vorarbeiter und Farrenwärter in den Dienst der
Gemeinde.
Dem Farrenwärter oblag die
Vatertierhaltung der Gemeinde. Er war für die Pflege der Bullen, Eber
und Ziegenböcke zuständig, für die Tiere zum Deckakt und führte die
Deckregister. Darüber hinaus hatte er für den Futter- und Strohvorrat
zu sorgen, die Stallungen und Sprungstände in Ordnung zu halten.
Die Tätigkeit als Farrenwärter
endete mit der Einführung der künstlichen Besamung im Jahre 1961.
Danach widmete sich Johannes Löb
voll seiner Aufgabe als Vorarbeiter bis er am 1. Dezember 1978 in den
Ruhestand trat.
Anschließen war er bis zum 31.
Dezember 1983 teilzeitbeschäftigt im Vollzugsdienst und in der Feldhut.
|
|
|
zurück
|
|
Die Hebamme |
 Margarethe
Keil Margarethe
Keil
geb. am 18.12.1889 in Leutershausen,
gest. am 21.03.1975 in Heidelberg |
|
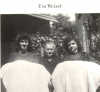 Eva
Wetzel, geb. Schwefel Eva
Wetzel, geb. Schwefel
geb. am 18.03.1887 in Leutershausen,
gest. am 30. 07.1961 in Weinheim |
|

Margarethe Keil war von 1921 bis 1961 als
Hebamme in Leutershausen tätig. Sie erfuhr eine Ausbildung als
Krankenschwester und absolvierte dann Lehrgänge zur Qualifikation als
Hebamme. Ihre erste Geburt in Leutershausen waren Zwillinge. Sie
leistete Hilfe bei der Geburt von Hilde und Hedwig Schrödersecker.
Neben ihrem Beruf als Hebamme hat Margarethe Keil viele soziale
Dienste geleistet und ärmeren Mitmenschen Hilfe und Unterstützung
gewährt. Margarethe Keil war die letzte Gemeindehebamme. Immer mehr
gingen die Hausgeburten zurück und den Geburten auf den
Entbindungsstationen der Kliniken wurde der Vorzug gegeben. Damit war
für die Hebamme vor Ort die Arbeitsgrundlage entzogen und eine weitere
freiberufliche Tätigkeit verschwand aus dem dörflichen Leben.
Eine unangenehme Erfahrung aufgrund ihres Berufes
mußte die Gemeindehebamme gleich nach Kriegsende machen. Der Ort war
von amerikanischen Soldaten besetzt. Margarethe Keil wurde zur
Geburtshilfe gerufen zu einer Zeit als für die Bevölkerung
Ausgangssperre verhängt war worauf bekanntlich neue Erdenbürger keine
Rücksicht nehmen. Sie machte sich auf den Weg zur Geburtshilfe, lief
natürlich prompt in eine Kontrolle und wurde vorübergehend
festgenommen bis geklärt war, zu welchem Zweck sie sich im Ort
bewegte.
|
|
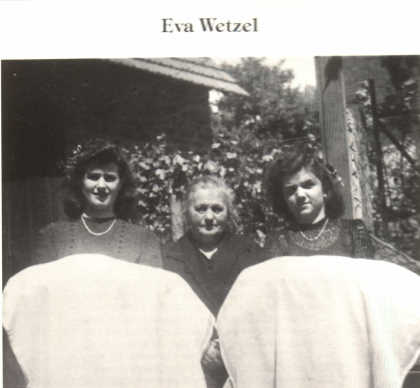
Eva Wetzel hat als 20jährige den Beruf als
Hebamme ergriffen. Über 50 Jahre hinweg hat sie diesen Beruf ausgeübt
und sich dabei im Ort großes Vertrauen erworben. Sie wurde ob ihrer
Berufskenntnisse besonders geschätzt. Ihr Amt war in jener Zeit nicht
nur berufliche Erfüllung, sondern erforderte viel Nächstenliebe und
fürsorgliche Hilfe, vor allem in den Kriegs- und Nachkriegsjahren. In
wie vielen Häusern und Familien die „Schwefelsamm“ ein- und auszugehen
hatte und wie vielen jungen Erdenbürgern sie in diesen fünf
Jahrzehnten ihres Wirkens in Leutershausen die Wiege aufstellte, soll
hier nicht aufgezählt werden. Nicht selten war es vorgekommen, daß sie
in manchen Familien in der dritten Generation als Geburtshelferin
amtierte. Bei all dem fand Eva Wetzel keine Rast und Ruhe. Ihr
Haupterwerb war nach ihrer Verehelichung die Landwirtschaft mit Obst-
und Gemüsehandel. Gar oft wurde die halbe Nacht „Markt“ gerichtet und
bis ins Morgengrauen am Bett einer werdenden Mutter verbracht.
Erholung und Entspannung, Ausflugsfahrten oder gar Urlaub kannte sie
nie. Tage der Erholung in jener Zeit waren für Frau Wetzel die
Teilnahme an Fortbildungskursen in Heidelberg und Karlsruhe. 1957 gab
sie ihre Tätigkeit als Ammebäsel und Storchentante auf.
|
|
|
zurück
|
| Der
Huf- und
Wagenschmied |
 Kurt
Elfner Kurt
Elfner
geb. am 29.03.1918 in Leutershausen |
|
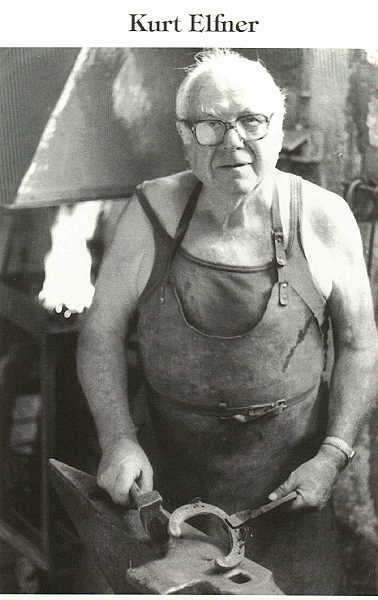
Er entstammt einer in diesem
Beruf verhafteten Handwerksfamilie. Großvater Andreas betrieb ab 1873
im Anwesen Großsachsener Straße 4, damals noch Hauptstraße 16, eine
Schmiede.
Ab 1904 übernahm der Vater Adam
Elfner die Schmiede, die dann 1949 an dessen Sohn Kurt Elfner
überging. Zuvor legte dieser die Meisterprüfung und die Prüfung zum
Hufbeschlagschmied an der Hufbeschlagschule Karlsruhe ab.
Neben dem Beschlagen der Pferde
und der als Zugtiere eingesetzten Kühe gehörte die Pflege der Hufe und
Klauen ebenso zur Arbeit des Schmieds wie das Aufziehen der
Eisenreifen auf die Wagenräder und auch deren Reparatur.
Die Elfner-Schmiede wurde bis zum
Jahre 1963 betrieben.
Danach betätigte sich der rüstige
Rentner als Hufschmied noch auf den umliegenden Bauernhöfen und
Reitplätzen und reparierte auch landwirtschaftliche Geräte.
Heute steht er seinem Enkel Peter
Mildenberger mit Rat und Tat zur Seite, der am 1. März 1996 in der
Hauptstraße 5 einen Schlossereibetrieb eröffnet hat.
|
|
|
zurück
|
| Die
Krautschnitterin |
 Maria
Hüller, geb. Bock Maria
Hüller, geb. Bock
geb. am 17.07.1902 in Leutershausen,
gest. am 20.10.1982 in Leutershausen |
|
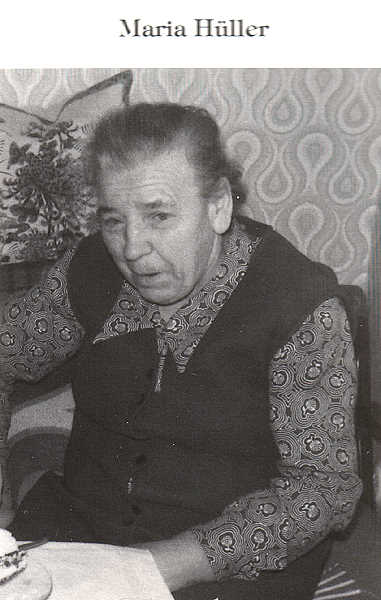
Maria Hüller, geb. Bock, Tochter
des früheren Polizeidieners Adam Bock, hat in jungen Jahren schon
einen wertvollen Dienst im Ort übernommen, den der Krautschnitterin.
Im Spätjahr, nach der Erntereife des Weißkrauts und nach Anlieferung
und Kauf von Filterkraut, war sie Tag für Tag mit ihrem Krauthobel
unterwegs um ihrer Arbeit nachzugehen. Bis spät in die Nacht hinein
wurde das Kraut fein geschnitten, denn jede Hausfrau wollte so bald
als möglich, das Sauerkraut aus dem Keller holen. Maria Hüller ging
von Haus zu Haus und alle im Dorf kannten die Krautschnitterin. Sie
war eine begehrte Person, denn in früheren Jahren gab es kein
Frischgemüse in den Wintermonaten zu kaufen um es der Familie zu
servieren. Da wurden sauere Bohnen und natürlich das Sauerkraut gerne
auf den Tisch gebracht, das aus eigener Erzeugung stammte und im
Keller reifte. Dort standen die „Krautstenner“, große Steinzeuggefäße,
in die das Kraut nach dem Schneiden frisch eingestampft wurde.
Aufgabe der Krautschnitterin war
es, das Kraut zu putzen, mit dem Krautbohrer den Strunk zu entfernen
um dann das Kraut mit dem Krauthobel zu schneiden.
|
|
|
zurück
|
| Der
Küfer |
 Alois
Beichel Alois
Beichel
geb. am 26.07.1902 in Leutershausen,
gest. am 20.03.1971 in Mannheim |
|

Er erlernte nach der Entlassung
aus der Volksschule und der Rückkehr seines Vaters Valentin Beichel
aus dem Krieg von 1918 bis 1921 im elterlichen Betrieb das
Küferhandwerk. Nach den Lehrjahren und bestandener Gesellenprüfung zog
es ihn in die Fremde. In seinen Wanderjahren erweiterte er seine
Kenntnisse im Stuttgarter Raum und in Bickensohl am Kaiserstuhl. Nach
Hause zurückgekehrt arbeitete er ab 1922 in Käfertal bei der Firma
Josef Herwerth, Weinbrennerei und Likörfabrik im Holzfach und in der
Brennerei. Ab Mai 1926 unterstützte er wieder seinen Vater und
besuchte den Meisterkurs in Weinheim. Am 23. April 1927 bestand er die
Meisterprüfung und am 18. August 1931 wurde er als Inhaber des
väterlichen Betriebes in die Handwerksrolle eingetragen. Neben seiner
Tätigkeit als Küfer übte er zusammen mit dem Vater sowie Lehrlingen
und Gesellen den Beruf des Landwirts und Schnapsbrenners aus. Seit
1903 besaß man das Brennrecht als Abfindungsbrennerei für
Stoffbesitzer. Im zweiten Weltkrieg war er zum Zolldienst an die
Grenze zwischen Luxemburg und Belgien eingezogen. Aus der
Kriegsgefangenschaft in Frankreich kehrte er im Mai 1946 zurück. Der
Vater war 1945 verstorben.
Die Arbeit des Küfers in
Werkstatt, Hof und Keller war hart, mühsam und jahreszeitlich bedingt.
Das Holz (Eiche, Kastanie) mußte ersteigert, gekauft und gelagert
werden. Es wurde je nach Bedarf für Weinfässer, Zuber, Butten und
Kübel gesägt, gehobelt, gebogen und geformt, Reparaturen auch bei
Jauchefässern kamen hinzu.
Die Tätigkeiten als Küfer waren
hauptsächlich im Spätsommer, Herbst und Winter nach der Obsternte und
der Traubenlese gefragt. Die Apfel- und Traubenmühle und die Kelter
waren fast täglich in Betrieb. Während der Wintermonate mußte der neue
Wein von der Hefe abgelassen und die Fässer für die weitere Lagerung
und den Ausbau des begehrten Haustrunks gereinigt werden.
Die Abkehr von der Weinlagerung
in Holzfässern und die damit verbundene Einführung der Plastik- und
Edelstahlbehälter bedeutete nicht nur für das Küferhandwerk sondern
auch für die Faßfabriken das Ende.
|
|
|
zurück
|
| Der
Maßschneider |
 Heinrich
Mück Heinrich
Mück
geb. am 21.02.1893 in Kürnbach,
gest. am 03.07.1974 in Leutershausen
Willy Salopiata
geb. am 05.01.1921 in Millau / Kreis Lyck
(Ostpreußen)
|
|
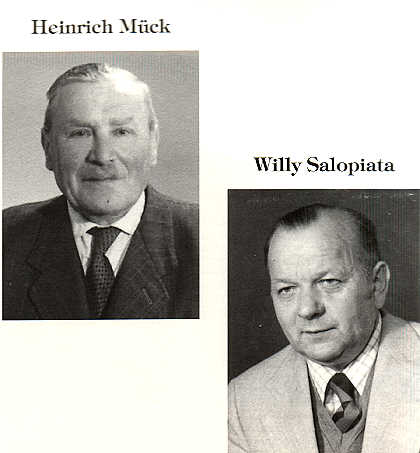
Heinrich Mück, der das
Herren-Maßschneiderhandwerk erlernte, machte sich im Jahre 1920 in
Leutershausen nach Ablegung der Schneider-Meisterprüfung in der
heutigen Martin-Stöhr-Straße selbständig. Das Ansteigen des
Kundenstammes machte eine Vergrößerung des Betriebes erforderlich, der
ab Herbst 1925 durch die Fertigstellung des Neubaues in der
Friedrichstraße 11 dorthin verlegt wurde. In der nun vorhandenen
größeren Werkstätte waren zeitweise fünf Gesellen und ein Lehrling
tätig. Am 1. Oktober 1953 war dann der Schwiegersohn Willy Salopiata
als Teilhaber in des Schneidergeschäft seiner Schwiegervaters
eingetreten, das dann als Geschäft Mück & Salopiata, Herren- und
Damen-Maßschneiderei in die Handwerksrolle eingetragen war. Im Jahre
1966, mit Zunahme der Konfektionskleidung und dem damit verbundenen
Kundenrückgang, wurde der Handwerksbetrieb ausgelöst.
Bevor es die nach Normalmaßen im
voraus gefertigten Herren- und Knabenanzüge sowie Damen- und
Mädchenkleider zu kaufen gab, war die Bevölkerung genötigt, die
Kleidungsstücke bei einem Schneider oder einer Schneiderin anfertigen
zu lassen.
|
|
|
zurück
|
| Der
Sattler |
 Wilhelm
Bock Wilhelm
Bock
geb. am 20.02.1904 in Leutershausen,
gest. am 14.12.1982 |
|

Der Landwirtssohn absolvierte von
1918 bis 1921 eine Lehre als Sattler in Weinheim in einem
Handwerksbetrieb in der dortigen Grundelbachstraße, wofür er
allerdings keinerlei Vergütung erhielt.
Dieser Beruf hat einen engen
Bezug zur Landwirtschaft. 1924 machte sich der junge Handwerksgehilfe
selbständig und so wurde in der Vordergasse 22 neben der
Landwirtschaft auch eine Sattlerwerkstatt betrieben. Die
Meisterprüfung legte Wilhelm Bock 1939 ab. In seinen ersten
Berufsjahren gab es in Leutershausens Landwirtschaft noch keine
Motorisierung. 154 Pferde wurden seinerzeit vor Wagen und Pflug
gespannt. Die Feldgemarkung reichte bis zur heutigen Fenchelstraße und
der Brandenburger Straße. Da es auf Leutershausener Gemarkung keine
Wiesen gab, mußten Heu und Öhmd auf der Waid und den Weinheimer und
Hemsbacher Wiesen geerntet werden. Mit dem Pferdefuhrwerk und der
Mähmaschine wurde in den frühen Morgenstunden so zwischen 2 und 3 Uhr
dorthin aufgebrochen. Die Heu- und Öhmdernte wurde dann nach zwei bis
drei Tagen mit großen Heuwagen, oft spät in der Nacht, eingebracht. Da
mußten die Geschirre der Pferde und hie und da auch Kühe in Ordnung
sein. Wurde tagsüber ein Geschirr beschädigt, wurde es oft in der
Nacht wieder repariert, damit es am nächsten Morgen wieder in Ordnung
war und den Pferden aufgelegt werden konnte. So gab es während der
Sommermonate viel zu tun und der Bockesattler fand oft kaum Zeit zum
Schlafen. Ruhiger ging es in den Wintermonaten zu. Da wurden dann neue
Geschirre angefertigt und größere Reparaturen durchgeführt. Oft war
die Werkstätte, da sie gut geheizt war, für die Bauern auch ein
Kommunikationsort an dem Neuigkeiten ausgetauscht wurden.
Die Motorisierung in der
Landwirtschaft begann nach der Währungsreform. Der erste Schlepper in
Leutershausen wurde 1935 von gräflich vom Wiser’schen Hofgut in
Betrieb genommen. Wenn auch mit der Motorisierung die Sattlerarbeit
etwas zurückging, war ein berufliches Betätigungsfeld durch die
Reparatur von Artikeln für die Reiterei sowie von Taschen und
Schulranzen gegeben. Wilhelm Bock jedenfalls führte seinen Beruf bis
in hohe Alter aus.
|
|
|
zurück
|
| Der
Stuhlflechter |
 Peter
Probst Peter
Probst
geb. am 28.06.1895 in Leutershausen,
gest. am 06.01.1970 in Heidelberg |
|
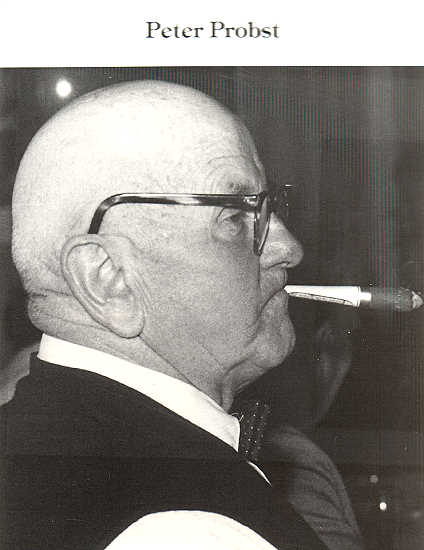
Peter Probst war gelernter Maurer
und hat als solcher über viele Jahre in Mannheim gearbeitet. Zuletzt
war er bei der Fa. Heinrich Kraft, Bauunternehmen in Leutershausen
beschäftigt. Hier lag das Hauptgebiet seiner Tätigkeit bei der Ver-
und Bearbeitung von Sandsteinen an Neubauten oder Erstellung von
Mauern und bei der Durchführung von Reparaturarbeiten. Peter Probst,
ein Maurer alter Schule, hat auch den „Petersbrunnen“ in der Steig
errichtet. Der Brunnen verdankt seinen Namen der Tatsache, daß neben
Peter Probst weitere Leutershausener mit dem Vornamen Peter an der
Errichtung beteiligt waren und zwar als Planer Architekt Peter Göhring,
als Hilfsmaurer Peter Schneider und der Spengler und Installateur
Peter Weber.
Das Peter Probst auch als
Stuhlflechter tätig war ist darauf zurückzuführen, daß die Maurer für
ihren Lebensunterhalt in den Wintermonaten selbst sorgen mußten. In
der kalten Jahreszeit, in der nicht gearbeitet werden konnte, gab es
keinerlei staatliche Unterstützung. Peter Probst suchte eine
Tätigkeit, die er in der warmen Stube im Winter ausführen konnte. Da
er handwerklich sehr geschickt war, interessierte er sich für das
Stuhlflechten. Schwester Lisbia von der kath. Schwesternstation hat
ihm das Stuhlflechten beigebracht und für sie hat er dann auch den
ersten Stuhl, mit Sitz und Lehne aus Geflecht, gefertigt. Peter Probst
fand für seine Tätigkeit als Stuhlflechter im Ort schnell Anerkennung
und genügend Arbeit, denn er fertigte nicht nur neue Stühle an,
sondern führte auch Reparaturarbeiten aus.
Stuhlrohrgeflechte hielten in
England Einzug, als Charles I. einen reich geschnitzten Ebenholzstuhl
mit einem Sitz aus Rohrgeflecht geschenkt bekam. Der Stuhl stammte aus
Indien und war nach Europa eingeführt worden. Populär wurden die
Stühle mit Rohrgeflecht in den 1670iger Jahren. Das Rohrgeflecht wird
aus Rotangrohr gewonnen, das aus der botanischen Familie der Palmen
stammt und daher keine Pflanze aus unserer Gegend ist. Das Rotangrohr
ist im Gegensatz zu andern Palmen eine Kletterpalme, die hauptsächlich
in den feuchten Tropenwäldern Indiens, Indochinas und den Malaiischen
Archipels vorkommt.
|
|
|
zurück
|
| Der
Wagner |
 Michael
Gärtner Michael
Gärtner
geb. am 04.06.1882,
gest. am 10.02.1977
|
|

Michael Gärtner erlernte den
Beruf des Wagners, ein Handwerk, das künstlerischen Einschlag hat,
sehr geschätzt und mit der Landwirtschaft verbunden war. Er machte
sich im Jahre 1906 selbständig und führte seinen Handwerksbetrieb bis
1966.
Wagner (auch Stellmacher)
stellten die Holzarbeiten an Wagen für Güter- und Personenbeförderung
und Ackergeräten her. Die Arbeit bestand darin, die Räder, die aus
Naben, Speichen und Felgen zusammengesetzt wurden sowie die Gestelle
und die Wagenkästen aus gut getrockneten Hölzern anzufertigen. Das
zähe und elastische Eschenholz eignete sich vorzüglich für
Gestellteile; Ulmen- und Lindenholz für Naben und Speichen. Für die
Herstellung des Wagenkastens und der Radfelgen wurde gerne zum Holz
der Buche gegriffen. Fichte, Tanne und Kiefer lieferten die zum
Wagenbau nötigen Bretter und Verschalungen. Das Holz der Pappel, Linde
und Weide wurde hauptsächlich zu Vertäfelungen benutzt.
Die Bearbeitung der einzelnen
Bauteile sowie das Zusammenfügen derselben erforderte einige
Geschicklichkeit vom Handwerker, vor allem auch gutes und scharfes
Werkzeug. Unentbehrlich war die Hobelbank zum Einspannen und
Festhalten der Arbeitsstücke und der Radbock zum Eintreiben der
Speichen in der Nabe. Darüber hinaus war in der Wagnerei das
Vorhandensein von Sägen der verschiedensten Art, spezieller Hobel wie
Stab-, Kehl-, Nut-, und Falzhobel, Zugmesser mit gerader und gebogener
Schneide, verschiedene Bohrer wie Schnecken-, Löffel- und
Zentrumbohrer erforderlich, die mit Hilfe der Drehleier oder der
Bohrmaschine bewegt wurden. Stemmeisen, Schraubzwingen und
Schmirgelriemen ergänzten das Werkzeug.
Mit der Motorisierung musste der
Wagner die Herstellung des Hauptgegenstandes seines Gewerbes, den
Ackerwagen einstellen. An seine Stelle trat die Rolle, ein großer
Tafelwagen mit gummibereiften Rädern. Er wird in der Fabrik gefertigt
und seine Reparatur geschieht nicht mehr durch den Wagner, sondern vom
Schlosser für die Eisenteile und vom Schreiner für die Holzteile.
|
|
|
zurück |